Ich kann schon verstehen, dass mittlerweile viele den Mund verziehen, wenn sie den Begriff „Burnout“ hören oder lesen. Manchmal kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass es für den einen oder anderen, der gerade ein bisschen überarbeitet ist, ganz chic tönt, wenn er anklingen lässt, dass er burnoutgefährdet sei.
Dieser inflationäre Gebrauch des Burnoutbegriffes wirkt andererseits aber einer ernsthaften Auseinandersetzung mit einem schon bedeutsamen Gesundheitsproblem unserer Zeit stark entgegen. Im Moment habe ich den Eindruck, dass wir uns vor allem an den Polen bewegen: auf der einen Seite ein inflationärer Gebrauch des Begriffes, auf der anderen Seite eine Tabuisierung der damit verbundenen Problematiken, vor allem dann, wenn es in irgendeiner Weise konkret werden soll.
Vorbildlich empfinde ich da im Moment vor allem wie der Hannoveraner Fußballprofi Markus Miller mit seinem eigenen Burnoutsyndrom umgegangen ist. Offenbar relativ frühzeitig (also bevor er im ganz „tiefen Burnoutloch“ war) hat er eine konsequente Entscheidung getroffen und sich Anfang September in stationäre Behandlung begeben. Unaufgeregt aber auch sehr offen hat er zuvor über seine psychischen Probleme informiert und ist jetzt, 11 Wochen später, wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Auch darüber hat er die Öffentlichkeit nüchtern und mit großer Offenheit informiert.
Was wir dringend benötigen, ist eine sachliche Diskussion über Burnout, ohne Dramatisierung, aber auch mit der notwendigen Offenheit und Ernsthaftigkeit. Menschen wie Markus Miller und sein (durch den Selbstmord des Nationaltorwarts Robert Enke vor zwei Jahren entsprechend sensibilisierter) Arbeitgeber Hannover 96 zeigen, wie es gelingen kann, gesund wieder in den Beruf zurückzukehren. Wenn dieser Umgang mit Burnout Schule macht, dann sind wir alle einen großen Schritt weiter.

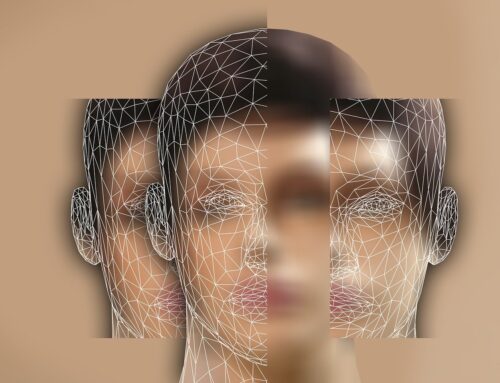



Hinterlasse einen Kommentar