Der Vorschlag ist aus meiner Sicht bis heute einer der besten zum Thema „Freiheit und Verantwortung“. Er lautet, dass die USA doch die Freiheitsstatue an der Ostküste mit einer Verantwortungsstatue an der Westküste ergänzen mögen. Er stammt vom berühmten Neurologen und Holocaustüberlebenden Viktor Frankl, der ihn bei seinen Vortragsreisen auf der anderen Seite des Atlantiks häufig gegenüber seinen amerikanischen Zuhörerinnen und Zuhörern gemacht hat.
Freiheit und Verantwortung gehören zusammen
Frankl machte damit deutlich, worauf schon vor ihm viele andere immer wieder hingewiesen haben. Freiheit und Verantwortung gehören untrennbar zusammen. Die eine ist ohne die andere nicht zu haben.
Leider werden diese Zusammenhänge in jüngerer Zeit immer wieder „vergessen“ oder auch bewusst in Abrede gestellt. Immer wieder wird eine Freiheit gefordert, die letztendlich nur darin besteht, dass jeder Einzelne ohne Einschränkung tun und lassen kann, was er will. Das aber ist eine stark verkürzte Version, um nicht zu sagen eine Perversion der Freiheit. So läuft sie auf ein plumpes Recht des Stärkeren hinaus.
Zwei Dimensionen der Freiheit
Und ein Recht des Stärkeren kann jemand nur fordern, wenn er nicht „nur“ die Verantwortung von der Freiheit trennt (und sie damit pervertiert). Gerade aktuell können wir leider immer wieder beobachten, dass bestimmte Menschen(gruppen) gleichzeitig ein weiteres Prinzip der französischen Revolution entsorgen: das der „Egalité“, der Gleichheit. Doch die Freiheit bindet sich auch an die Vorstellung, dass kein Mensch wertvoller als der andere ist, dass folglich jeder Mensch den gleichen Anspruch auf Freiheit hat. Daraus ergibt sich wiederum, dass die Freiheit eines jeden Menschen spätestens da endet, wo die des anderen anfängt. Eigentlich eine banale Erkenntnis, die einer inneren Logik folgt.
Gerade im Feld der Gesundheit werden diese Zusammenhänge fast täglich sichtbar:
-
Freiheit als Mitverantwortung – die „Wir-Dimension“
Ob Masernimpfung, verantwortungsvolle Antibiotikanutzung oder das simple Daheimbleiben bei Infekten: Wer seine individuellen Freiheitsrechte in Anspruch nimmt, beeinflusst stets auch die Freiheitsräume anderer. Die Pandemie-Jahre haben gezeigt, wie fragil das Gleichgewicht zwischen persönlicher Entscheidungsfreiheit und kollektiver Schutzpflicht ist. Hochleister in Wirtschaft, Wissenschaft und Sport kennen die Systemlogik: Ein ausgefallener Schlüsselspieler beeinträchtigt das ganze Team; eine infizierte Laborleitung legt bisweilen ein Forschungsprojekt lahm. Verantwortung heißt hier, Risiken nicht zu externalisieren, sondern bewusst zu managen – sei es durch Prävention, transparente Kommunikation oder das Vorleben evidenzbasierter Entscheidungen.
-
Freiheit als Selbstverantwortung – die „Ich-Dimension“
Konstante Leistungsfähigkeit ist nicht gratis zu haben, sondern Resultat täglicher, oft unspektakulärer Routinen. Zahlreiche Langzeitstudien (u. a. Harvard Study of Adult Development und UK Biobank) belegen: Schlafqualität, Stressregulation, Ernährung und Bewegung erklären mehr Varianz in kognitiver und körperlicher Performance als jedes Gen-Paket oder Wearable-Gadget. Verantwortliche Selbstführung bedeutet daher, die eigene biologische Infrastruktur als strategische Ressource zu behandeln – mit denselben Prioritäten, die man für ein R&D-Portfolio oder eine Bilanz zieht. Wer diese Verantwortung ignoriert, zahlt langfristig mit Entscheidungsschwäche, Kreativitätsverlust und höheren Gesundheitskosten – Kosten, die die Freiheit stark beeinträchtigen können, wenn sie nicht solidarisch von der Gemeinschaft getragen werden.
-
Freiheit und Verantwortung als Leadership-Kompetenz
In einer Welt verdichteter Interdependenzen ist Gesundheit der Menschen und des Planeten nicht länger nur „Privatsache“. Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, aber auch Spitzensportlerinnen, Wissenschaftler oder Künstlerinnen sind Multiplikatoren: Ihre Haltung prägt Sicherheitskulturen, beeinflusst Gesundheitsverhalten ganzer Organisationen und stiftet gesellschaftliche Normen. Leadership in der Post-Pandemie-Ära heißt daher, gesundheitsbezogene Freiheitsräume aktiv zu gestalten – etwa durch belastbare Remote-Work-Regeln, präventive Check-Ups oder Mental-Health-Budgets –, statt sie dem Zufall oder kurzfristigen Marktlogiken zu überlassen.
Nicht Freiheit von etwas, sondern Freiheit zu etwas
Äußere Freiheit ist auf vielfältige Weise bedroht, nicht zuletzt durch Kriege, die Folgen des Klimawandels oder auch Krankheit. Aber auch wer seinen Arbeitsplatz oder seine Wohnung verloren, einen gewünschten Studienplatz oder eine behördliche Bewilligung nicht erhalten hat, mag sich in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt fühlen.
Der eingangs erwähnte Viktor Frankl hat jedoch schon früh darauf hingewiesen, dass Freiheit niemals eine Freiheit von Bedingungen sein könne; weder von biologischen, psychologischen noch soziologischen Bedingungen, wie er ergänzte. Überhaupt sei Freiheit nicht eine Freiheit „von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas, nämlich die Freiheit zu einer Stellungnahme gegenüber all den Bedingungen.“
Damit war Frankl in der Lage, in Umgebungen, wie man sie sich unfreier kaum vorzustellen vermag, eine Haltung maximaler innerer Freiheit zu leben. Er hat fast seine ganze Familie während der Nazizeit verloren und selbst vier Konzentrationslager überlebt. Daran, dass diese Haltung ihm eine Resilienz (ein Wort, das er selbst nicht verwandt hat) verschafft hat, die wesentlich zu seinem Überleben beigetragen hat, hat er nie einen Zweifel gelassen. Allerdings hat er sich auch nie dazu verstiegen, zu behaupten, dass dies allein entscheidend gewesen sei und hat durchaus anerkannt, dass das Überleben häufig auch von bloßen Zufällen abhing.
„Freiheit zur Stellungnahme“ ist ein starker Resilienzfaktor
Wie auch immer, eine Freiheit zu etwas, statt von etwas ist alles andere als eine intellektuelle Übung ohne Alltagsrelevanz. Ganz im Gegenteil. Frankl hat uns gezeigt, dass uns diese Freiheit in buchstäblich jeder Situation zur Verfügung steht. Denn wenn sie selbst in der menschenverachtenden und nach äußeren Maßstäben maximal unfreien Welt eines Konzentrationslagers zur Verfügung steht, wo sollte sie nicht zur Verfügung stehen, so lange ein Mensch ein Bewusstsein hat?
Die „Freiheit zu etwas“ ist also eine Freiheit, die in ein verantwortlich-sein führt und da in erster Linie in die Verantwortung zur Stellungnahme. Was hier zunächst als Anforderung daher kommt und damit als zumindest potentieller Stressfaktor, ist aber in Wirklichkeit ein Resilienzfaktor. Denn wer sie annimmt und eine Haltung zu einem Geschehen entwickelt, der übernimmt nicht „nur“ Verantwortung, sondern auch die Selbstbestimmung in der Situation.
Freiheit und Verantwortung führen zur Selbstbestimmung
Wer seine Freiheit in Verantwortung zur Stellungnahme lebt, kann wie gesagt noch lange nicht alle Bedingungen kontrollieren. Er kann aber immer kontrollieren, wie er innerlich darauf reagiert. Er übernimmt also Kontrolle über seine Befindlichkeit und damit zu einem hohen Grad auch über sein Stressempfinden. Damit hat er auch in der härtesten Krise einen enorm hohen Grad an Freiheit und Selbstbestimmung erreicht. Ein Grad an Freiheit und Selbstbestimmung, mit dem er sich selbst die größte Chance zur Meisterung der Krise verschafft.


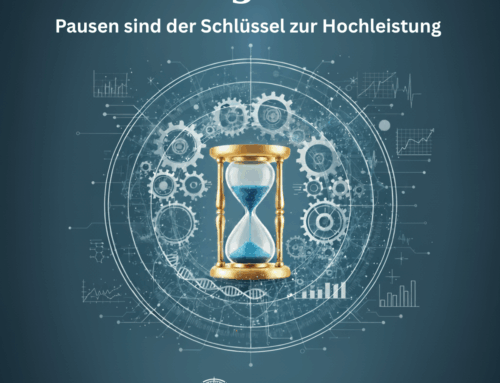
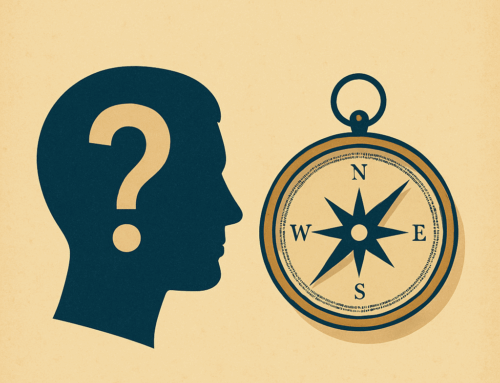


Hinterlasse einen Kommentar